Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kosten für ein außerhäusliches Arbeitszimmer können grundsätzlich unbeschränkt abgezogen werden. Einschränkungen kann es aber geben, wenn es sich im Miteigentum befindet.
Die Ferienzeit steht vor der Tür. Viele Schüler sind auf der Suche nach einem Ferienjob. Arbeitgeber sollten hier wissen, dass Ferienjobs für Schüler regelmäßig sozialversicherungsfrei sind.
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
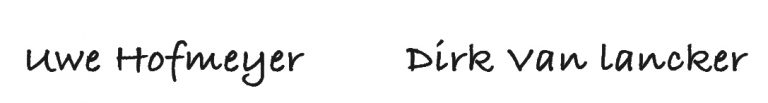
Einkommenssteuer
Hälftiges Miteigentum an außerhäuslichem Arbeitszimmer
Ein Ehepaar kaufte zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, die dann jeweils im hälftigen Miteigentum der Ehepartner standen. Dafür nahm das Ehepaar gemeinsam ein Darlehn auf. Zins und Tilgung zahlten sie von ihrem gemeinsamen Konto. Eine der Wohnungen nutzte die Ehefrau als steuer lich anerkanntes außerhäusliches Arbeitszimmer. Das Finanzamt berücksichtigte die nutzungsabhängigen Kosten wie Energie und Wasserkosten in voller Höhe als Werbungskosten, während es Abschreibung und Schuldzinsen nur zur Hälfte zum Abzug zuließ. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Bei gemeinschaftlichem Erwerb einer Wohnung ist davon auszugehen, dass jeder Miteigentümer die Anschaffungskosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil getragen hat. Grundstücks orientierte Kosten wie Abschreibung, Grundsteuern, Versicherungen und Schuldzinsen können daher nur entsprechend den Miteigentumsanteilen zu Werbungskosten führen.
Bewertung des privaten Nutzungswerts von Importfahrzeugen
 Wird der private Nutzungswert eines mehrheitlich betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs nach der 1 %-Methode ermittelt, ist dessen inländischer Brutto listenpreis zugrunde zu legen. Bei Importfahrzeugen, für die es keine inländischen Bruttolistenpreise gibt, ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie folgt vorzugehen:
Wird der private Nutzungswert eines mehrheitlich betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs nach der 1 %-Methode ermittelt, ist dessen inländischer Brutto listenpreis zugrunde zu legen. Bei Importfahrzeugen, für die es keine inländischen Bruttolistenpreise gibt, ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie folgt vorzugehen:
Ist das Fahrzeug mit einem bau-und typengleichen inländischen Fahrzeug vergleichbar, ist dessen Bruttolistenpreis anzusetzen. Andernfalls kann man sich an den inländischen Endverkaufspreisen freier Importeure orientieren. Im entschiedenen Fall wurde der tatsächlich in Rechnung gestellte Bruttopreis zugrunde gelegt. Ein ausländischer Listenpreis kann nicht angesetzt werden. Dieser spiegelt nicht die Preisempfehlung des Her stellers wider, die für den inländischen Neuwagenmarkt gilt.
National und international tätiger Fußballschiedsrichter erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Fußballschiedsrichter selbstständig, also nicht als Arbeitnehmer tätig sind und auch am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen. Sieerzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb und unterliegen der Gewerbesteuer. Damit war ein deutscher Schiedsrichter, der im Ausland auch Spiele der internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA geleitet hatte, mit seiner Anfechtung der vom Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbescheide nicht erfolgreich.
Der Bundesfinanzhof urteilte darüber hinaus, dass der Schiedsrichter an ausländischen Spielorten keine Betriebsstätte begründet hatte. Einzige Betriebsstätte war allein die inländische Wohnung des Schiedsrichters als Ort der Geschäftsleitung. Damit unterliegen auch die ausländischen Einkünfte der deutschen Gewerbesteuer.
Obwohl sich der Schiedsrichter während der von ihm geleiteten Fußballspiele körperlich betätigte, erkannte ihn das Gericht nicht als Sportler im Sinne der Regelungen einiger Doppel besteuerungsabkommen an. So mit liegt das Besteuerungsrecht seiner Einkünfte bei der Bundesrepublik Deutschland und nicht bei dem Staat, in dem das Fußballspiel stattgefunden hat.
Krankheitskosten sind keine Sonderausgaben
Privat Krankenversicherte können oft eine Beitragserstattung erhalten, indem sie einen Teil ihrer Krankheitskosten selbst tragen. Diese selbst getragenen Kosten können jedoch nicht als Beiträge zur Krankenversicherung im Rahmen des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden. Mit dieser Entscheidung führt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Kostentragung bei einem Selbstbehalt fort. Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu Krankenversicherungen abziehbar, die im Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen. Nur diese dienen letztlich der Vorsorge.
Hinweis
Übersteigen die selbst getragenen Krankheitskosten die zumutbare Belastung, können sie möglicherweise aber als außergewöhnliche Belastung abziehbar sein.
Gesellschaft / Gesellschafter
Veräußerung von Anteilen und Erwerb durch die GmbH
Veräußert ein Gesellschafter seine Anteile an die GmbH, an der er beteiligt ist, stellt dies ein Veräußerungsgeschäft dar. Die dazu gesellschaftsintern vorzunehmende Umgliederung einer freien Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Rücklage führt nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten des veräußernden Gesellschafters.
Grundsätzlich können nur solche Aufwendungen des Gesellschafters den (nachträglichen) Anschaffungskosten einer Beteiligung zugeordnet werden, die zu einer offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Dass die Umgliederung nun nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten führt, lässt sich damit begründen, dass zum Zeitpunkt der Umgliederung kein Anspruch auf Gewinnausschüttung besteht, weil es keinen Gewinnverteilungsbeschluss gibt. Auch kann diese Umgliederung nicht einer Kapitalzuführung des Gesellschafters von außen gleichgestellt werden. Ebenso sind die handelsrechtlichen Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz unbeachtlich. Sie betreffen alleine die Gesellschaftsebene und haben keine Auswirkung auf die steuerliche Beurteilung des Vorgangs beim veräußernden Gesellschafter.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Arbeitnehmer / Arbeitgeber
Musikschullehrerin kann freie Mitarbeiterin sein
Über den arbeitsrechtlichen Status einer Musikschullehrerin, d. h. über die Frage, ob sie Arbeitnehmerin oder freie Mitarbeiterin war, hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden. Die Lehrerin hatte auf Feststellung des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses geklagt. Das Gericht sah sie jedoch als freie Mitarbeiterin an.
Anders als im Falle allgemeinbildender Schulen, wo die Lehrkräfte in aller Regel als Arbeitnehmer einzustufen seien, sind Musikschullehrer nur dann als Arbeitnehmer anzusehen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbart haben oder im Einzelfall Umstände hinzutreten, die auf den für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses erforderlichen Grad persönlicher Abhängigkeit schließen lassen. Als solche Umstände kommen das Recht des Schulträgers, die zeitliche Lage der Unterrichtsstunden einseitig zu bestimmen, den Unterrichtsgegenstand oder Art und Ausmaß der Neben arbeiten einseitig festzulegen, eine in ten sivere Kontrolle nicht nur des jeweiligen Leistungsstands der Schüler, sondern auch des Unterrichts selbst oder die Inanspruchnahme sonstiger Weisungsrechte in Betracht.
Daran fehlte es jedoch im vorliegenden Fall. Ein Honorarvertrag bezeichnete die Klägerin als freie Mitarbeiterin. Er räumte der Musikschule keinerlei Weisungsrechte ein. Im Einzelunterricht konnte die Klägerin die Termine frei vereinbaren. Ausgefallene Stunden waren nachzuholen. Das alles sprach für ein freies Mitarbeiterverhältnis.
Schwangere bei Massenentlassungen nicht immer geschützt
Schwangeren Arbeitnehmerinnen darf nach europäischem Recht im Rahmen von Massenentlassungen grundsätzlich gekündigt werden. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Der Kündigungsgrund hänge in diesem Falle nicht mit der Schwangerschaft zusammen. Der Gekündigten müssen dabei aber die Gründe und sachlichen Kriterien für ihre Kündigung mitgeteilt werden, nach denen sie gekündigt wurde.
Hinweis
Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen.
Wohnungseigentümer / Mieter / Vermieter
Erhöhte Absetzung für eine Eigentumswohnung
Die Erwerber eines Penthouses machten nach dessen Fertigstellung Sonder abschreibungen geltend. Die Wohnung war vollständig auf ein vorhandenes denkmalgeschütztes Gebäude eines Mehrfamilienhauses aufgebaut worden. Obwohl die Eigentümer eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde vorlegten, lehnte das Finanzamt die Inanspruchnahme der erhöhten Absetzung mit der Begründung ab, es handele sich hier um einen Neubau.
Der Bundesfinanzhof machte deutlich, dass allein eine solche Bescheinigung maßgebend für die Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen ist. Das Finanzamt hat diese im Besteuerungsverfahren ohne weitere Rechtmäßigkeitsprüfung zugrunde zu legen, es sei denn, die Bescheinigung wäre nichtig und deshalb unwirksam. Dies traf in dem geschilderten Fall nicht zu, sodass die Sonderabschreibung zu Recht in Anspruch genommen wurde.
Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei Vermietungseinkünften
Fallen nach der Veräußerung eines Vermietungsobjekts hierfür noch Schuldzinsen an, können sie steuerlich insoweit noch als Werbungskosten geltend gemacht werden, als der Verkaufspreis nicht zur Darlehnstilgung ausreicht. Wird das Darlehn aber nicht zurückgezahlt, weil hierfür bspw. hohe Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen, sind die Schuldzinsen auch dann nicht abzugsfähig, wenn der Steuerpfl ichtige behauptet, vom Verkaufspreis ein anderes Vermietungsobjekt kaufen zu wollen. Allein die Absicht genügt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht. Die angebliche Investitionsabsicht in ein noch zu erwerbendes und nicht bestimmtes Vermietungsobjekt reicht nicht aus, um den notwendigen wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietungstätigkeit zu begründen.
Vermieter trägt Darlegungs -und Beweislast bei Betriebskostenabrechnung
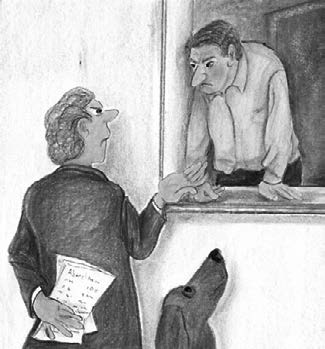 Stellt ein Vermieter extrem hohe Nachforderungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, hat er für die erhobene Forderung den Beweis zu erbringen, dass die abgerechneten Kosten auch tatsächlich angefallen sind. Der Mieter muss den Nachforderungsbetrag nicht zahlen, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers in der Abrechnung besteht. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem entschiedenen Fall sollte ein Mieter für seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung leisten. Er sollte an geblich fast die Hälfte der Heizenergie des gesamten Mehrfamilienhauses ver braucht haben, wobei seine Wohnung gerade einmal 13 % der gesamten Wohnfl äche ausmachte. Der Mieter forderte die Vorlage der Ablesebelege der Verbrauchseinheiten für die übrigen Wohnungen und verweigerte die Nachzahlung. Der Vermieter verweigerte die Einsichtnahme in die Unterlagen und klagte auf Zahlung der Betriebskosten.
Stellt ein Vermieter extrem hohe Nachforderungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, hat er für die erhobene Forderung den Beweis zu erbringen, dass die abgerechneten Kosten auch tatsächlich angefallen sind. Der Mieter muss den Nachforderungsbetrag nicht zahlen, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers in der Abrechnung besteht. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem entschiedenen Fall sollte ein Mieter für seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung leisten. Er sollte an geblich fast die Hälfte der Heizenergie des gesamten Mehrfamilienhauses ver braucht haben, wobei seine Wohnung gerade einmal 13 % der gesamten Wohnfl äche ausmachte. Der Mieter forderte die Vorlage der Ablesebelege der Verbrauchseinheiten für die übrigen Wohnungen und verweigerte die Nachzahlung. Der Vermieter verweigerte die Einsichtnahme in die Unterlagen und klagte auf Zahlung der Betriebskosten.
Nach Auffassung des Gerichts hat der Mieter zu Recht die Nachzahlung verweigert. Denn nicht der Mieter habe die Unrichtigkeit der Abrechnung darzulegen und zu beweisen, sondern der Vermieter deren Richtigkeit. Zudem sei der Mieter zur Zahlungsverweigerung berechtigt gewesen, da ihm die Abrechnungsunterlagen nicht vollständig zur Verfügung gestellt worden seien. Der Mieter habe das Recht, die erstellte Betriebskostenabrechnung des Vermieters zu prüfen und hierzu alle erforderlichen Unterlagen des Vermieters einzusehen, soweit dies zur sachgerechten Überprüfung erforderlich ist.
Verfahrensrecht
Erteilung einer verbindlichen Auskunft: Anforderung an die Darstellung des noch nicht verwirklichten Sachverhalts
Ein Hobbypilot hatte sich an sein Finanzamt gewandt und um Erteilung einer verbindlichen Auskunft gebeten. Er nutzte ein Flugzeug, dessen Eigentümer ein US-amerikanischer Trust war, deren Begünstigter er selbst war. Eine weitere Gesellschaft war als Treuhänder des rechtlichen Eigentümers in die USamerikanische Luftfahrzeugrolle eingetragen. Der Pilot wollte u. a. wissen, welche umsatzsteuerlichen Folgen eine Änderung der Eigentümerstruktur hätte. Das Finanzamt lehnte die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ab. Man begründete dies damit, dass der Sachverhalt nicht ausreichend beschrieben und außerdem Verträge dazu nur unvollständig vorgelegt worden seien. Das Finanzgericht Nürnberg hat sich dieser Auffassung angeschlossen. Voraussetzung für eine verbindliche Auskunft ist, dass eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten Sachverhalts vorliegt. Ist in diesem Zusammenhang ein Vertrag maßgebend, so ist grundsätzlich der vollständige Vertragsentwurf einzureichen.
Sonstiges
Feststellung der Zahlungsunfähigkeit einer GmbH
Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit ein, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen und darf grundsätzlich keine Zahlungen mehr leisten. Verstößt der Geschäftsführer gegen seine Insolvenzantragspfl icht, muss er mit erheblichen straf und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass der Schuldner die fälligen Zahlungspfl ichten nicht erfüllen kann. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, innerhalb von drei Wochen die benötigten Finanzmittel zu beschaffen, um die Liquiditätslücke auf unter 10 % zurückzuführen.
Nach Auffassung der zuständigen Senate für Insolvenz- und Strafrecht des Bundesgerichtshofs sind in der Liquiditätsbilanz zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die im maßgeblichen Zeitpunkt verfügbaren und innerhalb von drei Wochen fl üssig zu machenden Mittel zu den am selben Stichtag fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten in Beziehung zu setzen. Für die Berechnung nicht explizit erwähnt werden die innerhalb von drei Wochen nach dem Stichtag fällig werdenden und eingeforderten Verbindlichkeiten, sog. Passiva II. Der für das Gesellschaftsrecht zuständige Senat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Rechtsprechung nunmehr ausdrücklich verlangt, dass bei Prüfung der Zahlungsunfähigkeit auch die Passiva II einbezogen werden.
Hinweis
Ob sich die anderen Senate dieser Rechtsauffassung anschließen, bleibt abzuwarten. GmbH-Geschäftsführern ist aber dringend zu empfehlen, bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit der GmbH heute schon die Passiva II zu berücksichtigen.
Impressum
Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg
Herausgeber und Redaktion: Deutsches Steuerberater- institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin
Illustration: U. Neuwert
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater. Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Herausgeber.

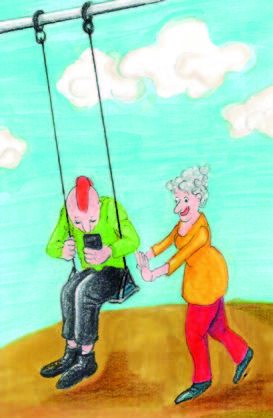 Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann. Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswilligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat. Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich.
Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann. Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswilligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat. Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich.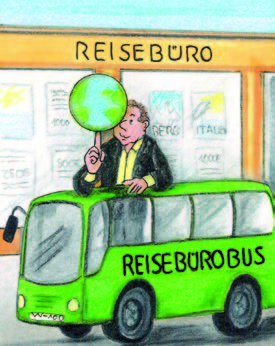 Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und Reisevorleistungen. Voraussetzung für die Anwendung dieser Differenzbesteuerung ist, dass der die Leistung ausführende Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Reisevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. Die Reiseleistung darf nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt sein. Vielmehr ist die Sonderregelung derzeit auf Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in Anspruch genommene Reiseleistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die derzeitige deutsche Regelung widerspricht europäischem Recht und muss daher geändert werden. Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Diffe- renz sind europarechtswidrig. Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden oder die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Auch das widerspricht den europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen daher künftig entfallen.
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und Reisevorleistungen. Voraussetzung für die Anwendung dieser Differenzbesteuerung ist, dass der die Leistung ausführende Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Reisevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. Die Reiseleistung darf nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt sein. Vielmehr ist die Sonderregelung derzeit auf Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in Anspruch genommene Reiseleistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die derzeitige deutsche Regelung widerspricht europäischem Recht und muss daher geändert werden. Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Diffe- renz sind europarechtswidrig. Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden oder die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Auch das widerspricht den europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen daher künftig entfallen. Das hat der Bundesfinanzhof im Fall einer selbstständig tätigen Vermittlerin von Finanzanlagen entschieden, die 2006 bei Betriebseinnahmen von 100.000 € eine Ansparabschreibung von 300.000 € beanspruchte. Dieser lag die geplante Anschaffung von drei Luxus-Pkw mit Anschaffungskosten von 400.000 € (Limousine), 450.000 € (Sportwagen) und 120.000 € (SUV) zugrunde.
Das hat der Bundesfinanzhof im Fall einer selbstständig tätigen Vermittlerin von Finanzanlagen entschieden, die 2006 bei Betriebseinnahmen von 100.000 € eine Ansparabschreibung von 300.000 € beanspruchte. Dieser lag die geplante Anschaffung von drei Luxus-Pkw mit Anschaffungskosten von 400.000 € (Limousine), 450.000 € (Sportwagen) und 120.000 € (SUV) zugrunde.
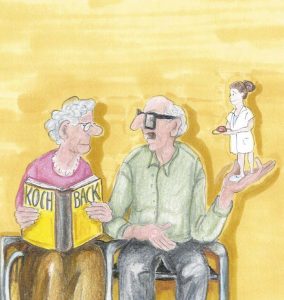 Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbringung in einem Alten oder Pflegeheim sind dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von den Aufwendungen eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in den Unterbringungskosten auch Lebensführungskosten enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen entstehen und deswegen insoweit nicht außergewöhnlich sind.
Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbringung in einem Alten oder Pflegeheim sind dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von den Aufwendungen eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in den Unterbringungskosten auch Lebensführungskosten enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen entstehen und deswegen insoweit nicht außergewöhnlich sind. Eine aus Kommanditgesellschaften bestehende Unternehmensgruppe (Sponsor eines Fußballvereins) schloss Arbeitsverträge mit Fußballspielern, Trainern oder Betreuern (Aktive) ab. Sie wurden als kaufmännische Angestellte/Bürokaufleute bezeichnet, vertragsgemäß bezahlt und mussten auf diesen Positionen laut Vertrag 40 Stunden pro Woche für die Unternehmensgruppe arbeiten. Tatsächlich waren die Aktiven allerdings nicht für den Sponsor, sondern Vollzeit und unter Profibedingungen für den Fußballverein tätig, der für die Überlassung kein Entgelt entrichten musste. Damit ersparte der Verein die ansonsten übliche Vergütung für die Arbeitnehmerüberlassung durch die Unternehmensgruppe. Das war Gegenstand der Schenkung.
Eine aus Kommanditgesellschaften bestehende Unternehmensgruppe (Sponsor eines Fußballvereins) schloss Arbeitsverträge mit Fußballspielern, Trainern oder Betreuern (Aktive) ab. Sie wurden als kaufmännische Angestellte/Bürokaufleute bezeichnet, vertragsgemäß bezahlt und mussten auf diesen Positionen laut Vertrag 40 Stunden pro Woche für die Unternehmensgruppe arbeiten. Tatsächlich waren die Aktiven allerdings nicht für den Sponsor, sondern Vollzeit und unter Profibedingungen für den Fußballverein tätig, der für die Überlassung kein Entgelt entrichten musste. Damit ersparte der Verein die ansonsten übliche Vergütung für die Arbeitnehmerüberlassung durch die Unternehmensgruppe. Das war Gegenstand der Schenkung.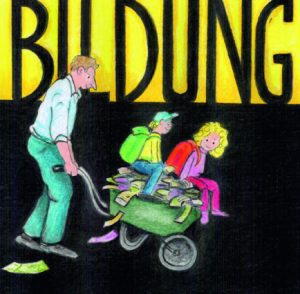 Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst zu einem Schulabschluss führen, aber ordnungsgemäß auf einen anerkannten Abschluss vorbereiten, sind begünstigt. Die staatliche Anerkennung bezieht sich in diesem Fall jedoch nur auf den anzuerkennenden Abschluss. Die weitere Voraussetzung, die ordnungsgemäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Gesetz keinem besonderen Anerkennungsverfahren durch eine Schulbehörde. Damit obliegt die Prüfung dieser Voraussetzung nach Auffassung des Bundesfinanzhofs entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung den Finanzbehörden. Diesen steht es jedoch frei, sich an die zuständige Schulbehörde zu wenden und deren Einschätzung zur Erfüllung der schulischen Kriterien, wie der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen anerkannten Abschluss, zu berücksichtigen.
Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst zu einem Schulabschluss führen, aber ordnungsgemäß auf einen anerkannten Abschluss vorbereiten, sind begünstigt. Die staatliche Anerkennung bezieht sich in diesem Fall jedoch nur auf den anzuerkennenden Abschluss. Die weitere Voraussetzung, die ordnungsgemäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Gesetz keinem besonderen Anerkennungsverfahren durch eine Schulbehörde. Damit obliegt die Prüfung dieser Voraussetzung nach Auffassung des Bundesfinanzhofs entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung den Finanzbehörden. Diesen steht es jedoch frei, sich an die zuständige Schulbehörde zu wenden und deren Einschätzung zur Erfüllung der schulischen Kriterien, wie der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen anerkannten Abschluss, zu berücksichtigen. Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen, ohne dies genauer zu defi nieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung einer IPAdresse, vom Personenbezug ausgegangen werden.
Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen, ohne dies genauer zu defi nieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung einer IPAdresse, vom Personenbezug ausgegangen werden.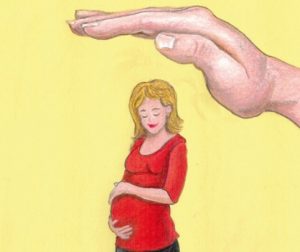 Arbeitgeber sollen Beschäftigungs-verbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur noch dann in Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine unverantwortbare Gefährdung zu vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt eine unverantwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren.
Arbeitgeber sollen Beschäftigungs-verbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur noch dann in Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine unverantwortbare Gefährdung zu vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt eine unverantwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren.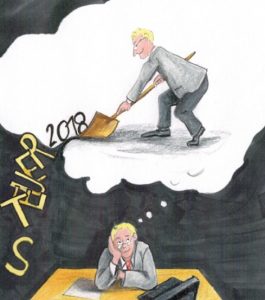 Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.